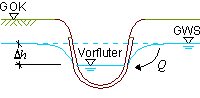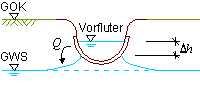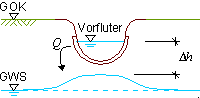Befindet sich ein großer Vorfluter im Modellgebiet oder am Gebietsrand, besteht oft ein direkter Kontakt mit dem Grundwasser. Die Wasserspiegelhöhe kann dann als festes Potential (POTE) an den entsprechenden Knoten angesetzt werden. Die resultierende Ein- oder Ausflussmenge ergibt sich als Reaktionsmenge. Wenn das Oberflächengewässer Wasser aus dem Grundwasserleiter aufnimmt, spricht man von Exfiltration. Wenn das Oberflächengewässer Wasser in den Grundwasserleiter abgibt, bezeichnet man dies als Infiltration.
Kleinere Gewässer haben meistens keinen direkten Grundwasserkontakt. Aufgrund von Sohldichtungserscheinungen (Kolmation) oder der Ausbildung einer ungesättigten Zone zwischen Gewässer und Grundwasseroberfläche ist die Austauschströmung behindert.
Die folgenden Bilder verdeutlichen die einzelnen Begriffe bezogen auf den Grundwasserleiter:
|
|
|
|
|
Exfiltration des Grundwassers in den Vorfluter |
Infiltration des Gewässers in das Grundwasser |
Infiltration mit Abrissbeschränkung |
Die Richtung der Austauschströmung und die Wassermenge werden durch eine - meist lineare - Beziehung zwischen Wasserstand im Oberflächengewässer und dem Grundwasserstand ausgedrückt und als Leakage-Funktion bezeichnet. Der Leakagekoeffizient [1/s] ist der Quotient aus der In- bzw. Exfiltrationsmenge Q (bezogen auf die Gewässerbreite und die Länge eines Gewässerabschnittes) und der mittleren Potentialdifferenz. Insbesondere für die Infiltration gibt es in der Praxis einen Maximalwert, der auch bei einer Erhöhung der Potentialdifferenz nicht mehr überschritten wird. Aber auch bei der Exfiltration kann bei bestimmten Problemstellungen ein Grenzwert sinnvoll sein.
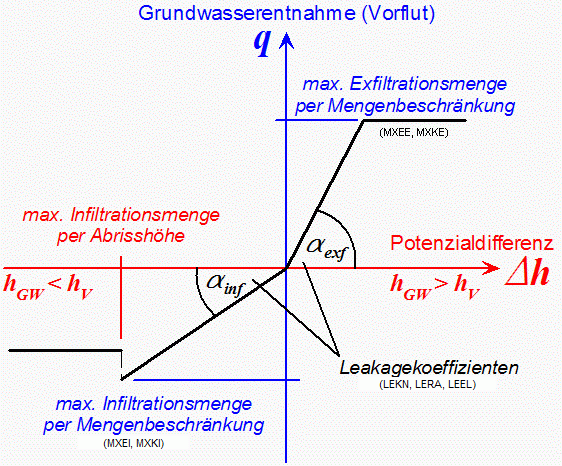
Prinzipielle Darstellung der Leakage-Funktion
Eine Leakage-Beziehung kann nicht nur bei einem linienbezogenen Gewässer, sondern auch für flächenhafte Bereiche sinnvoll sein. In SPRING gibt es zur Eingabe der Leakage-Beziehung folgende Datenarten:
VORF: knotenbezogene Höhe des Wasserstandes im Oberflächengewässer
ABRI: Potentialdifferenz zwischen Vorflut- und Grundwasserstand, ab der keine Zunahme der Infiltrationsmenge mehr stattfindet (Abrisshöhe)
LEKN: Leakagekoeffizient eines Knotens
LERA: längenbezogener Leakagekoeffizient für einen Polygonzug
LEEL: Leakagekoeffizient für Elemente
LKFA: Verhältnis zwischen Exfiltration und Infiltration an Knoten (LEKN) bzw. Polygonen (LERA)
LEFA: Verhältnis zwischen Exfiltration und Infiltration in Elementen (LEEL)
MXKE: max. Exfiltrationsmenge für einen Polygonzug
MXEE: max. Exfiltrationsmenge für Elemente
MXKI: max. Infiltrationsmenge für einen Polygonzug
MXEI: max. Infiltrationsmenge für Elemente
Für eine Leakage-Berücksichtigung zwingend erforderlich sind Angaben der Datenart VORF sowie eine der drei Datenarten LEKN, LERA oder LEEL.
Leakage-Beziehung bei undurchlässigen Schichten
Ein Sonderfall einer flächenhaften Leakage-Beziehung ist der Wasseraustausch durch eine stauende oder geringdurchlässige Schicht. Diese Schicht über dem Grundwasserleiter behindert zwar den Anstieg des Grundwassers (vgl. max. Mächtigkeit des Grundwasserleiters), erlaubt aber - insbesondere bei stationären Betrachtungen - doch einen bedingten Wasseraustausch.
Die Eingaben für dieses Phänomen erfolgen durch folgende Datenarten:
UNDU: Mächtigkeit der undurchlässigen Schicht (Voraussetzung ist die Eingabe der Geländeoberfläche mit GELA )
LEEL: Die Interpretation des Wertes ist abhängig von der Eingabe für UNDU: UNDU>0: LEEL = vertikaler K-Wert der undurchlässigen Schicht in m/s; UNDU=0 bzw. keine Eingabe: LEEL = direkter Leakagekoeffizient in 1/Zeiteinheit.
VORF: Wasserstand des Oberflächengewässers (kann auf Geländehöhe gesetzt werden, falls keine offene Wasserfläche vorhanden ist)
In den folgenden Kapiteln wird die praktische Umsetzung einzelner Vorflutinteraktionen im Grundwassermodell anhand von typischen Beispielen erläutert.
 Flurabstandsregulierung durch einen Polderbrunnen
Flurabstandsregulierung durch einen Polderbrunnen