Aufruf durch: SPRING  Berechnung
Berechnung  Modellkalibrierung (Gradientenverfahren)…
Modellkalibrierung (Gradientenverfahren)…
Nachdem ein Grundwassermodell erstellt ist, d.h. alle bekannten bzw. abgeschätzten Parameter und Randbedingungen eingegeben sind, kommen bei einer Modellrechnung alle einzeln ermittelten Daten meist erstmals zusammen. Da viele Einflussgrößen nur geschätzt sind, ergeben sich in der Regel Abweichungen zu einem gemessenen Grundwasserzustand. Sind alle auffälligen Unverträglichkeiten (falsche Entnahmen, Randbedingungen etc.) beseitigt, ist der K-Wert normalerweise die unsicherste Größe.
Bei der Kalibrierung mit dem Gradientenverfahren können die Durchlässigkeitswerte der Elemente - ausgehend von einem Startwert - iterativ so verändert werden, dass eine gemessene Grundwasseroberfläche möglichst gut nachgerechnet wird. Es können folgende Modellarten bearbeitet werden:
2D-Horizontalmodelle
2D/3D-Modelle
3D-Modelle
Da die Kalibrierung durch stationäre Berechnungen erfolgt, ist es entscheidend, einen möglichst stationären Sollzustand zu verwenden! Der erstellte Sollzustand muss in sich widerspruchsfrei sein, d.h., die ermittelten Gradienten müssen immer mit der allgemeinen Fließrichtung übereinstimmen. Es können sich sonst unsinnige Durchlässigkeiten ergeben. Vorsicht ist vor allem bei Quellen und Senken sowie bei Wasserscheiden geboten.
Der Sollzustand wird durch die Eichpotentiale (Attribut EICH) definiert. Für jeden Knoten muss das Attribut EICH definiert sein. Zur Berücksichtigung aller Grundwasser beeinflussenden Daten sei auf die „Interpolation von Gleichenplänen“ verwiesen.
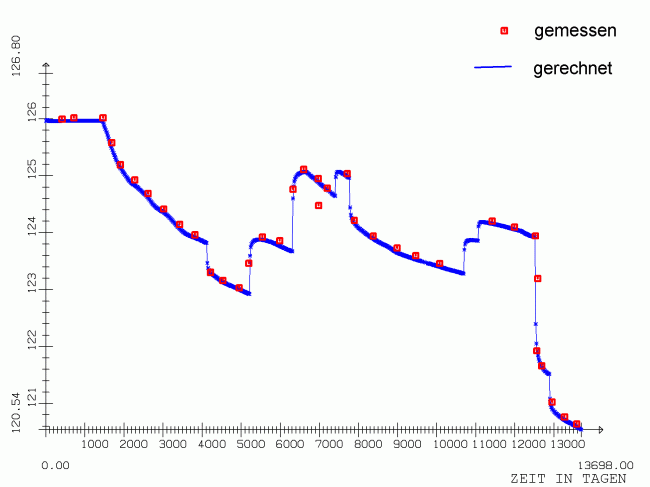
Beispiel einer instationär kalibrierten Ganglinie
In einem späteren Kapitel wird die Kalibrierung mit Hilfe der inversen Modellierung beschrieben.
 Iterative Kalibrierung der horizontalen K-Werte
Iterative Kalibrierung der horizontalen K-Werte
