Eine Bahnlinie ist diejenige Linie, die den Weg eines Wasserteilchens über eine Fließzeit t beschreibt. Die Berechnung von Bahnlinien erfolgt durch die Verfolgung des Weges eines imaginären Wasserteilchens durch Integration des Strömungsfeldes. Die Integration der Potentiale ergibt die Filtergeschwindigkeiten, die mittels folgender Gleichung in Abstandsgeschwindigkeiten umgerechnet werden:
mit
Dabei spielen zwei Dinge eine wichtige Rolle für die Genauigkeit der Linien:

Da je Element eine konstante Geschwindigkeit berechnet wird (bei einem linearen Ansatz für die Potentiale), muss die Diskretisierung des Modellgebiets in Bereichen mit wechselnden Gradienten entsprechend fein sein.

Für die Interpolation zwischen den Elementmittelpunkten geltenden Geschwindigkeiten muss ein gleichmäßiger Übergang gewährleistet sein.
In der praktischen Berechnung wird die Bahnlinie eine bestimmte Wegstrecke (s) weit mit der Anfangsgeschwindigkeit verfolgt, dann eine neue Geschwindigkeit interpoliert und weiterverfolgt. Die Wegabschnitte s müssen je nach Inhomogenität des Strömungsfeldes durch den Benutzer gewählt werden.
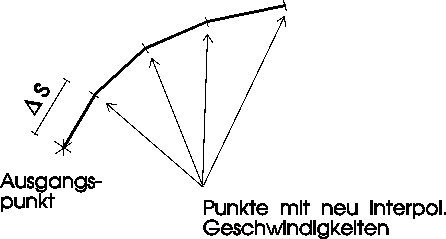
Berechnung einer Bahnlinie
Eine Problemstelle bei der Berechnung von Bahnlinien sind die Entnahmebrunnen. Wird diese Tatsache nicht als Nebenbedingung mit berücksichtigt, ergeben sich durch die wechselnden Strömungsrichtungen überschießende Zickzacklinien:
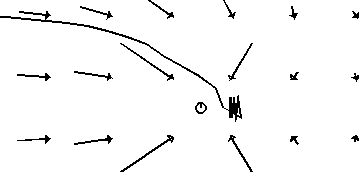
Bahnlinienberechnung an einem Brunnen ohne Nebenbedingung
Bessere Ergebnisse werden erzielt, wenn stattdessen überprüft wird, ob der neu berechnete Bahnlinienpunkt nahe an einem Förderbrunnen liegt. Ist dies der Fall, kann die Bahnlinie „gefangen“ werden:
Die Bahnlinienverfolgung endet, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

ein vorgegebener Zeitpunkt oder eine Wegstrecke wird erreicht,

es wird der Rand des Modellgebietes oder eine offene Wasserfläche erreicht,

die Bahnlinie wird von einem Knoten mit Entnahmemenge "eingefangen",

die Entfernung zwischen zwei aufeinander folgenden Bahnlinienpunkten unterschreitet eine vorgegebene Schranke.
Die Umsetzung bzw. die erforderlichen Eingaben in SPRING werden im Kapitel "Berechnen und Darstellen von Bahnlinien" erläutert.
Die Startpunkte für Bahnlinien können um Knoten, in Elementmittelpunkten oder auf beliebigen Koordinaten x, y, (z) liegen. Die Richtung der Bahnlinienverfolgung kann in Fließrichtung oder entgegengesetzt gewählt werden. Die zweite Möglichkeit bietet sich zur Bestimmung einer Schutzzone um einen Brunnen an (z.B. 50-Tage-Grenze). Auf den Bahnlinien können im Eingabedialog der Ploterstellung Zeitmarkierungen gesetzt werden, anhand derer dann manuell Isochronen konstruiert werden können.
Die Berechnung von instationären Bahnlinien unterscheidet sich nur dadurch, dass sich das Geschwindigkeitsfeld zu jedem Zeitschritt ändert. Zusätzlich zu den Bahnlinienabschnitten s wird deshalb überprüft, ob die verfolgte Fließzeit t nicht größer ist als die Zeitschrittlänge T.
 Berechnen und Darstellen von Bahnlinien
Berechnen und Darstellen von Bahnlinien
